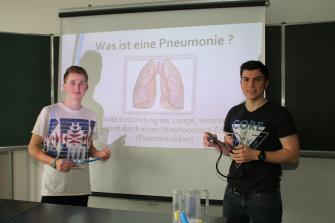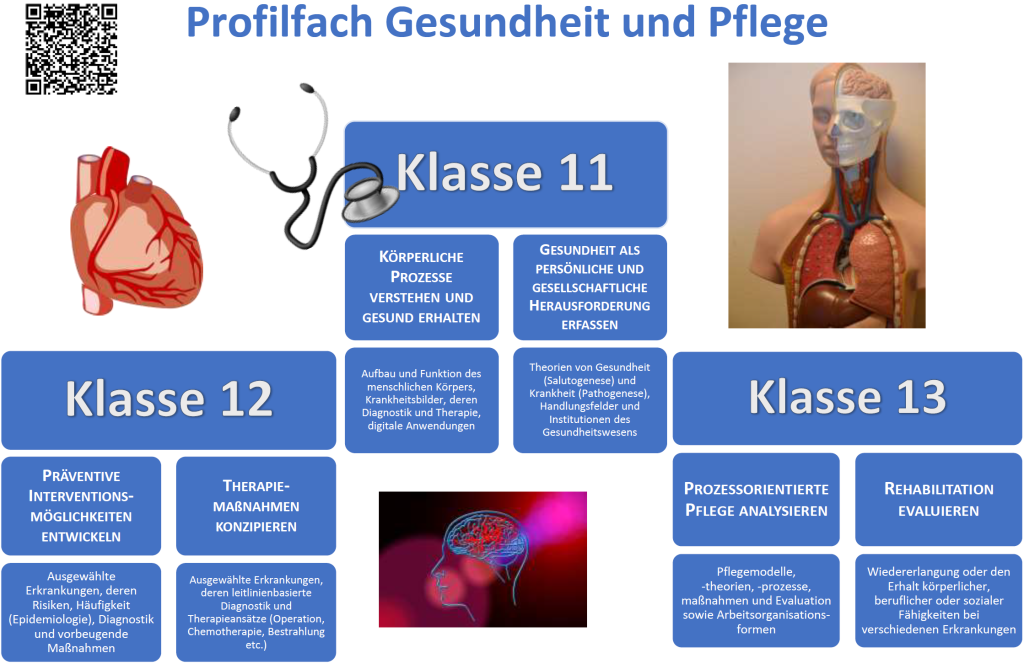Alle Schwerpunkte
- Berufliches Gymnasium – Allgemeines
- Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Ernährung (Ökotrophologie)
- Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Gesundheit-Pflege
- Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Sozialpädagogik
- Technik – Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (GMT)
- Technik – Schwerpunkt Informationstechnik (IT)
- Wirtschaft
- Wirtschaft – Internationale Klasse